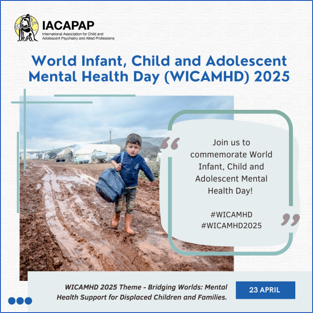Interdisziplinärer Appell aus Forschung und Fachpolitik
Es ist in den letzten Jahren ein parteiübergreifender Konsens entstanden, dass die Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eine Daueraufgabe der Bundespolitik ist und diese gesetzlich zu verankern ist.
Seit der breiten Skandalisierung von sexueller Gewalt im Jahr 2010 hat sich in der Politik, Forschung und Fachpraxis zur sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Deutschland auch dank der Bundespolitik viel getan. Aus dem früheren gesellschaftlichen Tabuthema und einer politischen Randständigkeit hat sich eine neue Qualität der politischen und fachlichen Aufmerksamkeit und Sensibilisierung entwickelt. Dazu beigetragen haben die Initiativen von Betroffenen, zivilgesellschaftliches Engagement, die Einrichtung des Amtes der*/des UBSKM (Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs), unabhängige Aufarbeitung sowie Forschungsförderung für Gesundheits- und Bildungsforschung zur Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche auf Bundesebene. Auch international wird der Bekämpfung sexueller Gewalt heute mehr Aufmerksamkeit gewidmet.
Gewaltfreies Aufwachsen ist Teil eines der Nachhaltigkeitsziele, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat. Im Rahmen des Sustainable Development Goal 16 der United Nations wird explizit als Ziel betont: „End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence and torture against children” (dt.: Beendigung von Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel und allen Formen von Gewalt und Folter gegen Kinder). Dieses Ziel reflektiert weltweite Forschungsbefunde zur Häufigkeit von Gewalt gegen Kinder und zu den langfristigen Folgen für die Individuen und die Gesellschaft.
Durch die Digitalisierung hat sich die weltumspannende Ausbeutung von Kindern, neben dem Menschenhandel, weiter verschärft und ist zu einem enormen Problem geworden, das wir neben den nationalen Fragestellungen im Kinderschutz ebenso beachten müssen, wie die Folgen von Gewalt gegen Kinder in kriegerischen Konflikten und auf der Flucht. Das gewaltfreie Aufwachsen von Kindern sowie die Sicherheit für Betroffene von Gewalt, dass sie mit gerechten Reaktionen und Hilfe und Unterstützung rechnen können, stellen – wie alle anderen Sustainable Development Goals (SDGs) – somit eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe dar.
Darüber hinaus ist gewaltfreies Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ein grundlegendes Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Demokratie und damit auch ein wesentlicher Faktor für die innere Sicherheit. Darum ist auch die interdisziplinäre Forschung zu sexueller Gewalt in Familien und den Schnittstellen zu sexueller Gewalt in anderen Kontexten weiter zu vertiefen.
Gegenwärtig befindet sich ein Gesetzentwurf – das sog. UBSKM-Gesetz – im parlamentarischen Verfahren. Die Anliegen dieses Gesetzesentwurfes sind überparteilich beraten und abgestimmt. Sie sollten nicht weiter aufgeschoben werden. Es umfasst auch die Anerkennung des zivilgesellschaftlichen Engagements vieler Betroffener und in der Beratungsarbeit und Aufarbeitung aktiver Personen, indem der Betroffenenrat und die Unabhängige Aufarbeitungskommission mit dem Amt des*/der Unabhängigen Beauftragten gesetzlich verankert werden. Zudem soll ein „Zentrum für Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ die UBSKM in der Wahrnehmung ihrer Berichtspflicht nach §7 des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen unterstützen. Dieses Zentrum, welches endlich ein staatliches Prävalenz-Monitoring dauerhaft etablieren und einen Überblick über relevante Forschungsergebnisse liefern soll, ist deshalb nicht nur für die Politikberatung, sondern auch für die Betroffenenbeteiligung und die Praxisberatung wichtig.
Darüber hinaus können beispielhaft drei weitere Herausforderungen genannt werden, die in den kommenden Jahren durch gesetzliche Regulierungen und interdisziplinäre Forschung bearbeitet werden müssen:
1. Sexuelle Gewalt im digitalen Alltag: Die technologiegestützte sexualisierte und sexuelle Gewalt ist in den letzten Jahren stark gewachsen (BKA, Europol), wobei das wahrgenommene Hellfeld nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Künstliche Intelligenz kann entsprechende Inhalte generieren, künstliche Intelligenz kann aber auch dafür eingesetzt werden, die Herkunft solcher Inhalte zu dechiffrieren oder Kinder und Jugendliche selbst dabei zu unterstützen, ihr Verhalten in sozialen Medien zu analysieren und ggf. individualisierte Rückmeldungen und Interventionen zum Schutz darauf abstützen. Zudem haben Digitale Medien und Beratung sowie Beratungstools wie „Chatbots“ eine große Bedeutung in der Orientierung bei der Hilfesuche und in der ersten Information. Insgesamt wird in der Präventions- und Interventionsforschung noch zu wenig beachtet, dass auch die Kindheit und Jugend in der Kindertagesbetreuung, Schule, im Studium und Beruf in einen analog-digitalen Alltag eingebunden sind.
2. Betroffenen- und Angehörigenbeteiligung: Seit Jahren wird die Stärkung der partizipativen Forschung mit Betroffenen und Angehörigen gefordert. Dennoch ist die methodologische und organisationale Absicherung bisher nur begrenzt geschehen. Die Anerkennung der Betroffenen durch die Forschung erfordert partizipative Forschungszugänge und eine organisationale Stärkung der Betroffenenorganisationen. Für diesen Bereich wären auch Begleit- und Unterstützungsprogramme für Betroffene erforderlich, die in Beteiligungsstrukturen mitarbeiten möchten und Untersuchungen zu Gelingensbedingungen z.B. bei der Betroffenenbeteiligung in Aufarbeitungsprojekten durchführen.
3. Recht und Verhalten: Zudem besteht eine Forschungslücke in der interdisziplinären Forschung zum Zusammenhang von Recht und Verhalten, auch bezüglich der Intervention bei verurteilten und nicht verurteilten Straftätern etc. Erst aktivere Forschung zu Fragen der Forensischen Begutachtung, aber auch zu den Verfahren z.B. in der Kinder- und Jugendhilfe und anderen Rechtsfeldern wird dazu führen, diesem Feld an der Schnittstelle von Gesundheits-, Sozial- und Rechtswissenschaften mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Weiterhin bedarf es eines intensiven bundespolitischen Engagements für den nachhaltigen Kinderschutz gegen sexuelle Gewalt in Deutschland. Nur so können die Interventions- und Hilfestrukturen weiter verbessert werden. Dies bedeutet nicht, die Bundesländer und Kommunen aus der Verantwortung zu nehmen, sondern anzuerkennen, dass die Bekämpfung sexueller Gewalt auch eine gesamtgesellschaftliche und bundespolitische Aufgabe ist.
Es ist zwar in den vergangenen Jahren eine beachtliche Sensibilisierung im institutionellen Gefüge des Aufwachsens erreicht worden. Dennoch besteht in der aktuellen bundespolitischen Lage eine Verunsicherung, wie die infrastrukturellen Herausforderungen einer abgestimmten Strategie z.B. zur Schutzkonzeptentwicklung in den Kindertagesstätten, in den Schulen und in der Kinder- und Jugendhilfe, erreicht werden soll.
Damit die Entwicklung nicht zum Erliegen kommt und in vielfältige Einzelinitiativen und regionale Schwerpunkte zerfällt, müssen die angelegten Strukturen nun gefestigt werden. Schutzkonzepte müssen überall wirksam werden. Berücksichtigung in der Schutzkonzeptentwicklung müssen auch Felder finden, die nahezu vollständig fehlen, wie z.B. der Schutz von jungen Menschen bei kommerziellen Anbietern. Sie können derzeit einen wachsenden „Marktanteil“ verbuchen. Hier steht der Bund in der Verantwortung.
Wenig wurde bis dato auch in die Frage investiert, wie Schutzkonzepte bei sexueller Gewalt in Familien greifen können. Institutionelle Schutzkonzepte sind nicht einfach transferierbar; hier müssen erst noch spezifische Ansätze entwickelt werden. Auch hier ist für eine Gesamtstrategie die Bundespolitik zusammen mit den Bundesländern gefordert.
Mit diesem Appell wird gefordert, dass die politischen Initiativen zur Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch die zukünftige Bundesregierung weiter gestärkt und nicht unterbrochen werden:
- Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche nachhaltig bekämpfen.
- Bundespolitisches Engagement gegen sexuelle Gewalt ressortübergreifend aufrechterhalten und weiter stärken.
- Unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Kindesmissbrauch (UBSKM) gesetzlich absichern und interdisziplinäre Forschung weiter fördern.
Erstunterzeichner*innen:
Prof. Dr. Sabine Andresen, ehemalige Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs; Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt a.M.
Prof. Dr. Meike Sophia Baader, bis 2024 Vorsitzende des Beirates der Förderlinie des BMBF zu
Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche; Professorin an der Universität Hildesheim
Prof. Dr. Karin Böllert, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ,
Senior-Professorin an der Universität Münster
Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, Sprecher des Zentrums für Traumaforschung der
Universität Ulm, Leiter des Kompetenzzentrums Kinderschutz in der Medizin Baden-Württemberg
Prof. Dr. Barbara Kavemann, Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen
Kindesmissbrauchs
Prof. Dr. Heinz Kindler, Deutsches Jugendinstitut (DJI)
Prof. Dr. Michael Kölch, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und
Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Universitätsmedizin Rostock; Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP)
Prof. Dr. Elisabeth Tuider, Leitung des Fachgebiets Soziologie der Diversität an der Universität Kassel
Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl, Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Sabine Walper, Vorstandsvorsitzende und Direktorin des Deutschen Jugendinstituts (DJI)
Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums, Professor an der Universität Hildesheim
Prof. Dr. Mechthild Wolff, ehemalige Vorsitzende des Beirats des Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Professorin an der Hochschule Landshut