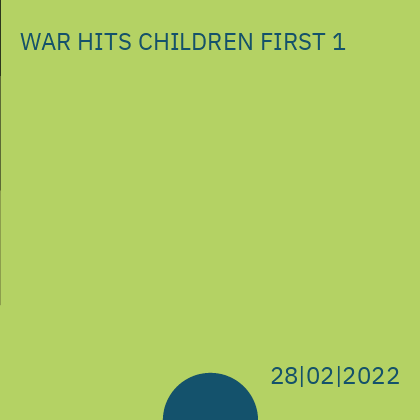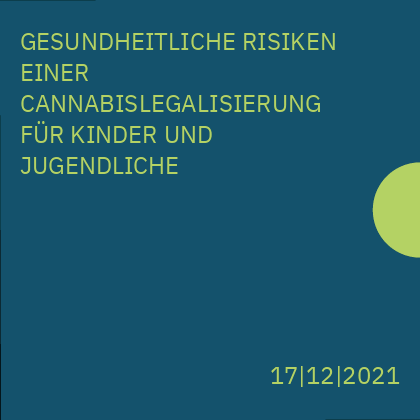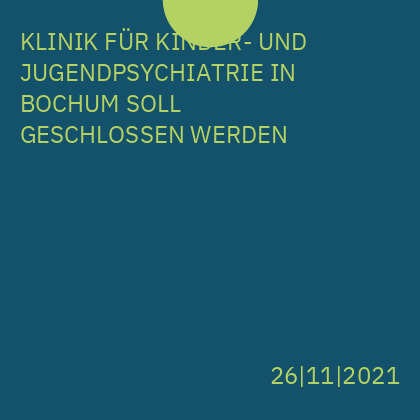Sehr geehrte Mitglieder der Regierungskommission,
herzlichen Dank, dass Sie in dem geplanten Reformprozess die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen berücksichtigen. Vereinbarungsgemäß finden Sie anbei unsere schriftlichen Ausführungen der in der Anhörung angesprochenen Punkte.
Vorab möchten wir Sie einführend mit dem Hintergrund und der Entwicklung der Versorgung von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen vertraut machen. Hierzu möchten wir auf zwei vom BMG geförderte Projekte zur Bestandsaufnahme der Versorgung und zur Weiterentwicklung der Versorgung aufmerksam machen. In diesen von der Aktion psychisch Kranke e.V. (APK) durchgeführten Projekten wurde sowohl der Versorgungsstand innerhalb des SGB V, aber auch in weiteren Sozialsystemen und anderen Sektoren außerhalb des SGB V analysiert. Zum anderen wurden Weiterentwicklungsbedarfe aufgezeigt, dies sowohl sektorübergreifend im SGB V, als auch über die Systemgrenzen des SGB V hinaus. Auch für besondere Gruppen, wie Kinder und Jugendliche mit Intelligenzminderung, Patient:innen mit Suchtstörungen etc. wurden entsprechende Weiterentwicklungsempfehlungen verfasst. Beide Projekte waren interdisziplinär und partizipativ unter Beteiligung von Angehörigen, der wissenschaftlichen Fachgesellschaft und den Verbänden angelegt und die Empfehlungen wurden konsensuell erarbeitet. (vgl. Handlungsempfehlungen der Aktion Psychisch Kranke; Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse APK)
Ambulante Versorgungsstrukturen
In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der niedergelassenen Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP) von ca. 600 auf 1.052 (Stand 31.12.2022, Ärztestatistik der Bundesärztekammer) erhöht. Die meisten Niedergelassenen arbeiten nach der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung (SPV) und versorgen in interdisziplinären Teams den bei weitem größten Teil der Patient:innen. Zusätzlich sind im ambulanten Bereich psychotherapeutisch tätig ca. 4.400 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen (Psychotherapeutenstatistik der BPthK) sowie Psychologische Psychotherapeut:innen mit Ermächtigung für Kinder und Jugendliche (Zahlen liegen uns nicht vor). In vielen schwach versorgten Regionen unterstützen Psychiatrische Institutsambulanzen die ambulante Regelversorgung.
Stationäre Versorgungsstrukturen
Die Bettenzahl in der KJP wurde seit den 1990er Jahren zuerst reduziert, wuchs jedoch in den letzten Jahren an auf aktuell rund 6.700 Betten (Destatis.de). Weiterhin gibt es ca. 4000 tagesklinische Behandlungsplätze. Die Bettenmessziffer (BMZ; Betten pro 10.000 EW unter 18 Jahren) schwankt zwischen den Bundesländern erheblich (Bayern: 3,2 – Thüringen: 10,5), wobei die großen bzw. bevölkerungsreichen Bundesländer wie BY, BW und NRW eher niedrige Bettenmessziffern aufweisen. Es gibt kein absolut objektives Maß für die notwendige Anzahl von stationären Behandlungsplätzen. Die Zahl ist u.a. abhängig von der ambulanten Versorgungssituation sowie dem Ausbau der Kinder- und Jugendhilfe im Versorgungsgebiet, da diese Klientel eine im Vergleich zur Normpopulation signifikant höhere Rate an psychischen Störungen aufweist. Über 70% aller Patient:innen, die stationär behandelt werden, erhalten auch Maßnahmen durch die Kinder- und Jugendhilfe (Beck, 2015). Zudem ist das Auftreten psychischer Störungen u.a. von sozialen Faktoren abhängig, d.h. Regionen mit höherer Armutsquote können auch höhere Bedarfe haben. Schließlich spielen geografische Faktoren eine Rolle: in urbanen Verdichtungsräumen können beispielsweise aufgrund guter Erreichbarkeit tagesklinische Behandlungsplätze vollstationäre Plätze eher ersetzen als in ländlichen Regionen mit größeren Distanzen.
Bereits initiierte Modifikationen der Versorgungsstrukturen und -konzepte
Die KJPP hat umfassende Schritte hin zu einer intensivierten Ambulantisierung genommmen. Hierbei sind nicht allein der Bereich der niedergelassenen Fachärzt:innen gemeint, sondern auch Behandlungen über die psychiatrischen Institutsambulanzen nach §118 SGB V (PIA), die stationsäquivalente Behandlung (StaeB, d.h. die Verlagerung stationärer Behandlung in das häusliche Umfeld), aber auch vermehrte tagesklinische Behandlungen, die den Vorteil der besseren Transmission von Behandlungsergebnissen in den Alltag erlauben.
Die stationäre Verweildauer in der KJPP sank in diesem Prozess von mehr als 100 Tagen vor dem Jahr 2000 auf 33 Tage im Jahr 2021 (Destatis.de). Dies ist einmal durch eine hohe Anzahl von Krisenaufnahmen in der KJPP bedingt, aber auch inhaltlich durch Umstellung der Behandlungskonzepte auf eine möglichst alltagsnahe und ambulante Behandlung, sowie eine Verbesserung der ambulanten Versorgung. Kennzahlen im Bereich der KJPP müssen also hochgradig differenziert eingeordnet werden und Veränderungen müssen mit Fachexpertise betrachtet werden. Per se sind z.B. Krisenaufnahmen nicht negativ zu bewerten, da diese z.B. auch in Behandlungskonzepten bei bestimmten Störungsbildern oder aber auch im Rahmen von Kooperationsverträgen mit dem wichtigsten Rehaträger, der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), explizit vorgesehen und sinnvoll sein können.
Veränderte Indikationsstellungen für stationäre Behandlungen
Aufgrund der intensivierten Ambulantisierung erfolgte zudem eine Veränderung der Indikation für stationäre Behandlung: nicht die Diagnose per se ist in den allermeisten Fällen Grund für eine stationäre Behandlung, sondern Probleme im psychosozialen Funktionsniveau oder Teilhabeeinschränkungen, z.B. fehlender bzw. nicht möglicher Schulbesuch, starke innerfamiliäre Konflikte, Folgebedarfe in der Kinder- und Jugendhilfe, akute Eigen- oder Fremdgefährdung. Die stationäre Behandlung erfolgt also fast immer bei hochkomplexen konstellativen Bedingungen aufgrund einer Diagnose, aber eben nicht immer wegen dieser Diagnose allein.
Diesem Umstand trägt auch das EPPIK-Projekt Rechnung (vgl. weiter unten), welches von den psychiatrischen Fachgesellschaften unterstützt wird, indem es nicht diagnosebezogen, sondern aufwandsbezogen personelle Ressourcen für die Patient:innen definieren will. Stationäre Behandlung in der KJPP dient nicht der „Heilung“, sondern der der Herstellung einer ambulanten Weiterbehandlungsfähigkeit. Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter sind regelhaft chronische Erkrankungen. Schwere Verläufe mit stationärer Behandlungsindikation bedürfen damit immer auch einer Versorgungskette von ambulant über stationär und zurück in das ambulante System.
Dezentrale KJPP-Versorgungsstrukturen sind essentielles Qualitätsmerkmal
Die Behandlung muss so wohnortnah wie möglich erfolgen. Jedoch sind die Versorgungsgebiete der KJPP-Kliniken im Schnitt dreimal so groß wie in der Erwachsenenpsychiatrie, so dass eine weitere Zentralisierung nicht möglich ist. Die Organisation der Versorgung in einem Netz hochspezialisierter wohnortferner Versorgungskliniken wäre auch aufgrund der in den allermeisten Fällen während des stationären Aufenthalts notwendigen Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe, mit Nachsorgemaßnahmen, oder bei Indikation einer Weiterbehandlung in der Institutsambulanz nicht kompatibel. Die im Bereich der KJPP wichtige Milieutherapie, die entsprechend dem Alter unserer Patient:innen auch pädagogische Maßnahmen auf Station und die Beschulung in Klinikschulen (und deren Kooperation mit Heimatschulen) beinhaltet, ist mit hochspezialisierten Einrichtungen grundsätzlich nicht vereinbar. Diese Einschätzung schließt nicht aus, dass für spezifische Störungsbilder spezifische Konzepte in den Kliniken etabliert werden oder für umschriebene Gruppen (schwere Aggression bei Intelligenzminderung, schwere Suchterkrankungen) spezialisierte Angebote vorgehalten werden können. Hierfür sehen die Landesplanungen überregionale Angebote vor.
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Spezifika in der Entwicklung der Versorgungsstrukturen sehen wir eine Reihe von Hindernissen, die KJPP in das geplante Reformvorhaben einzubeziehen. Diese Umstände möchten wir im Folgenden erläutern und darüber hinaus auf verschiedene konkrete Aspekte hinweisen, die vorrangig einer Reformierung bedürfen.
KJPP-Kliniken werden nicht durch DRG finanziert
Die Krankenhäuser nach §17d KHG (sog. Psych-Krankenhäuser und abteilungen) folgen einer fundamental anderen Entgeltlogik als Häuser nach §17b KHG. Die Fachgesellschaft hatte sich seinerzeit bereits sehr stark gegen Diagnosis-related-groups (DRG)-ähnliche Entgelte im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) ausgesprochen. Hintergrund war und ist, dass weder Diagnosen im Bereich der KJPP trennscharf den Aufwand beschreiben, noch die spezifischen, den Aufwand bedingenden Umstände der Behandlung (z.B. soziökonomischer Status der Patient:innen/Familien, notwendige Maßnahmen nach §35a SGB VIII, schulische Eingliederungsprobleme etc.) durch DRGs abbildbar wären. Der Gesetzgeber ist dem gefolgt und hat mit dem PEPP-System (dieses liefert einen diagnosespezifischen Multiplikator) und mit der Überarbeitung der weiterhin gültigen Bundespflegesatzverordung (BPflV), die ein krankenhausspezifisches Basisentgelt vorsieht, ein pauschalierendes Entgelt geschaffen, das einerseits Tagesentgelte vorsieht, die degressiv gestaltet sind, andererseits die höheren Aufwände prinzipiell abbilden kann (z.B. Kriseninterventionen mit kurzer Liegedauer). Insofern ist die Ausgangslage nicht mit der Somatik zu vergleichen.
Keine Fehlanreize zu Leistungsausweitungen
Anders als ggfs. in somatischen Bereichen bestehen in der KJPP keine Fehlanreize zu einer unnötigen Leistungsausweitung. Da mit der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) entsprechend Personal nachzuweisen ist pro behandelten Patienten, sind ehemals durchaus bestehende Fehlanreize wie eine hohe Belegung bei zu wenig Personal Vergangenheit. Die PPP-RL verhindert zudem eine Mengenausweitung insofern, als Leistungen ohne entsprechende Personalausstattung sanktioniert und Regresse geltend gemacht werden sollen. Insofern ist eine wesentliche Motivation für die geplante Krankenhausreform, nämlich die Aufhebung der ökonomischen Anreize zur Leistungsausweitung innerhalb DRG-Systems, für die KJPP nicht zutreffend.
Die stationären Kapazitäten in der KJPP sind praktisch ausgelastet. Während in 2019 die Auslastung bei 88,7% lag, erfolgte kurzzeitig in 2020 eine Reduktion auf 78,2% infolge der Covid-19-Pandemie, war jedoch bereits 2021 mit 85,6% wieder nahezu auf dem vor-pandemischen Niveau. Damit hat sich das System erstaunlich stabil während der Pandemie gezeigt, und es zeigt sich auch, dass die Bedarfe an stationären Kapazitäten im Bundesdurchschnitt relativ stabil sind. Aufgrund der eingangs beschriebenen unterschiedlichen BMZ schließt dies nicht regionale Bedarfe nach mehr voll- und teilstationären Behandlungsplätzen aus. Wie Kölch et al. (2023) nachweisen konnten, haben sich v.a. in Regionen mit eher niedriger BMZ Verweildauern deutlich verkürzt, was einem gestiegenen Aufnahmedruck und einer Zunahme an Krisenbehandlungen geschuldet sein dürfte (Kölch et al., 2023). Dies muss jedoch auch in Bezug zu den eingangs genannten Faktoren auf Landesebene analysiert und geplant werden. Es bestehen deutliche regionale Nachbesserungsbedarfe.
Was dem System auch insbesondere in den Regelungen der PPP-RL fehlt, ist eine Flexibilität in der Versorgung, da die Regelungen der PPP-RL zum Nachweis des Personals viel zu starr und stationsbezogen sind, so dass ein flexibles Reagieren auf temporäre Mehrbedarfe erschwert wird.
Es drohen Versorgungsengpässe
Angesichts des sich akut verschärfenden interdisziplinären Personalmangels und der gleichzeitig pandemiebedingt erhöhten Inanspruchnahme durch Patient:innen mit längerfristigem Versorgungsbedarf (Kölch et al., 2023) muss den wiederholten Forderungen nach allgemein mehr Bettenkapazitäten in der KJPP insgesamt eine Absage erteilt werden. Bettenmehrungen sind aus Sicht der DGKJP punktuell in wenigen Regionen mit sehr niedriger Bettenmessziffer sinnvoll und realistisch umsetzbar. So hat beispielsweise Baden-Württemberg aktuell eine neue Fachplanung für die Versorgung in der KJPP beschlossen. In manchen Regionen hat der Personalmangel im ärztlichen oder pflegerischen Bereich sogar zu Stations- oder Klinikschließungen geführt. Solange die Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie nicht fest in der Lehre als AO-Fach verankert wird auch im Rahmen der Reform der ApprO, wird sich auch die Zahl der Ärzt:innen, die im Fach KJPP einen Weiterbildung anstreben, wenig ändern. Vielmehr müssen nun dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um die Versorgung von Kindern mit schweren psychischen Erkrankungen sicherzustellen. In dieser Hinsicht besteht in verschiedenen Bereichen dringender Reformbedarf, und neben einem punktuellen Ausbau bietet sich ein „Umbau“ in stationsäquivalente oder ambulant intensive Behandlungsformen an, unter besonderer Berücksichtigung eines sektorübergreifenden Vorgehens
Vollständige Personalrefinanzierung
Der Anteil der Personalkosten in der stationären KJPP liegt bei mind. 80% der Kosten, während der Sachkostenanteil gering bleibt. Die Ausfinanzierung des für die Behandlung von Kindern mit psychischen Erkrankungen notwendigen, qualifizierten Personals durch die Kostenträger ist daher zentral für den Erhalt der Versorgungsstrukturen. Es kann nicht einerseits ein Mindeststandard für Personal als Voraussetzung durch die PPP-RL definiert werden und andererseits das geforderte Personal nicht ausfinanziert werden. Derzeit klagen die Kostenträger gegen mehrere diesbezügliche Schiedsstellenurteile.
Ohne vollumfängliche Gegenfinanzierung durch die Kostenträger (z.B. bei Tarifsteigerungen), der Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten wie z.B. auch bei Nachtdiensten, Bereitschaftsdiensten, Ausbildungskosten etc. wird eine Vorhaltung für die Versorgung z.B. von Notfällen verunmöglicht und die Träger in ein unlösbares Dilemma gebracht. Hier besteht der dringendste Bedarf von normativen Vorgaben.
PPP-RL ist kein Budgetfindungsinstrument
Die PPP-RL definiert Vorgaben für die zwingend erforderlichen Untergrenzen in der Personalausstattung. Sie ist explizit kein Personalbemessungsinstrument, wird jedoch systematisch missverstanden und zweckentfremdet als Finanzierungsgrundlage. Die psychiatrischen Fachgesellschaften haben daher ein Personalbemessungsinstrument entwickelt, das derzeit in einer Studie des G-BA Innovationsfonds evaluiert wird (EPPIK-Studie). Ein Aussetzen der Sanktionen bei Nichterfüllung der PPP RL sehen wir jedoch sehr kritisch, da dies für Krankenhausträger einen Anreiz darstellen könnte, entsprechendes Personal nicht vorzuhalten.
Psychiatrische Institutsambulanzen stärken
Psychiatrische Institutsambulanzen nach §118 SGB V nehmen eine wichtige Rolle in der Vermeidung oder Verkürzung von stationären Aufenthalten wahr, sie können auch die für die Patient:innen wichtige Behandlungskontinuität sichern. Sie können als Schlüssel für die Versorgungssteuerung bei Patient:innen dienen. Sie sind elementarer Bestandteil eines wie oben beschriebenen flexiblen Systems, das auch auf Mehrbedarfe reagieren kann und auch aufsuchende Behandlung ermöglichen könnte. Hier besteht aber dringender Reformbedarf. Die Möglichkeiten zur Patientenversorgung sind infolge unterschiedlicher Vergütungssysteme je nach Bundesland äußerst heterogen. Aufsuchende Behandlung ist z.B. nur bei entsprechenden Systemen wie dem sogenannten „bayerischen Modell“ ansatzweise möglich. Des Weiteren bestehen (historisch bedingte) Leistungsausschlüsse, die fachlich nicht mehr gerechtfertigt sind, wie z.B. eine parallele Richtlinienpsychotherapie, keine regelhafte Möglichkeit von Videosprechstunden oder e-Health Angeboten etc. Die Auswertung der PIA-Dokumentationsrichtlinie steht seit Jahren aus. Gleiche Versorgungsmöglichkeiten in der PIA in allen Bundesländern zu erhalten, wäre aber für Patient:innen und ihre Familien bundesweit essentiell. Neben der regional ungleichen Finanzierung sind Bau und Instandhaltungskosten von Räumlichkeiten der PIA bisher gar nicht vorgesehen, bzw. überhaupt nicht finanziert. Zudem müssen bundesweit Möglichkeiten für aufsuchende Behandlungsformen geschaffen werden, die eine Brücke zum Ausbau stationsäquivalenter Behandlungen schaffen. Um stationäre Bedarfe im ambulanten Setting effektiv erfüllen zu können und den Prozess der Ambulantisierung über das bereits erfolgte Maß hinaus weiter zu entwickeln, stellen Institutsambulanzen unverzichtbare und zentrale Strukturen dar, die es weiter zu entwickeln gilt.
Im Folgenden nehmen wir zu den von der Regierungskommission adressierten Punkte des Reformvorhabens im Detail Stellung:
1. Einteilung der Krankenhäuser in Level I bis III
Kinder- und jugendpsychiatrische Abteilungen werden von den Bundesländern nach eigenen Vorgaben in teils sehr großen Versorgungsgebieten geplant. Sie sind an den unterschiedlichsten Standorten repräsentiert: alleinstehende Tageskliniken, alleinstehende Fachkliniken, Abteilungen an Fachkrankenhäusern (Kinder- und Jugendmedizin, (Erwachsenen-)Psychiatrie), an Allgemeinkrankenhäusern und an Universitätskliniken. Perspektivisch könnte aber die Bewegung, die innerhalb der Häuser durch die geplanten Reformen entstehen wird, dazu führen, dass Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie an einem Level-I-Krankenhaus zu liegen kommen. Objektiv bedarf unser Fachgebiet einer logistischen Anbindung, aber keiner unmittelbaren Nähe zu einem Krankenhaus eines höheren Levels.
2. Zuweisung von Krankenhäusern zu spezifischer definierten Leistungsgruppen
Eine Klinik für KJPP mit Pflichtversorgung kann definitiv nicht in die vorgeschlagenen Leistungsgruppen aufgeteilt werden. Die derzeit gültigen Vorgaben der PPP-RL differenzieren in Regel- und Intensivbehandlung, wobei die Intensivbehandlung im Verlauf stets in eine Regelbehandlung übergeht. Beides muss in personeller Kontinuität möglich sein. Weiterhin hat die Wohnortnähe der Versorgung absoluten Vorrang angesichts der Notwendigkeit des therapeutischen Einbezugs von Familie und Umfeld. Die ambulante sowie (teil-)stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen in der KJPP erfolgt mit wenigen Ausnahmen ohne Spezialisierungen und Fokussierungen auf spezifische Störungsbilder, auch weil die Entwicklungstrajektorien früher psychischer Morbidität regelhaft mit komorbiden Verläufen einhergehen. Insofern wäre eine strenge thematische Aufteilung des Faches in Leistungsgruppen für die Versorgungsqualität abträglich und entspräche im Übrigen auch nicht der Tatsache, dass stationär behandelte Patient:innen sehr häufig komorbid mehrere Störungsbilder aufweisen.
Auch für besondere Gruppen, wie Patient:innen mit Intelligenzminderung oder Patient:innen mit Suchtstörungen eignen sich keine eigenen Leistungsgruppen. Hier ist zwischen allgemeiner Versorgung, die auch regional erfolgen muss und spezialisierten Einrichtungen zu unterscheiden, die aufgrund der besonderen Aufwände vornehmlich im personellen Bereich eine entsprechende Personalbemessung benötigen. Eine Leistungsgruppe erbringt keine Verbesserung per se in diesen Fällen. Die Krankenhausplanung in NRW hat nicht ohne Grund auf differenziertere Leistungsgruppen im Bereich KJPP verzichtet.
3. Teil-Finanzierung von Krankenhäusern über leistungsunabhängige Vorhaltebudgets
Die Frage nach Vorhaltebudgets in der KJPP muss differenziert betrachtet werden. Die PPP-RL macht Mindestvorgaben für die (teil-)stationäre Regel- und Intensivversorgung zu den Kernarbeitszeiten. In der Logik des PEPP-Systems wurden in die Kosten der PEPP auch Vorhaltekosten durch das InEK eingerechnet, und weitere strukturelle Vorhaltekosten über das Basisentgelt auf lokaler Ebene in den Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern verhandelt (siehe oben). In der Notfallversorgung gilt es Bereitschaftsdienste und eine 24-stündige Aufnahmebereitschaft sicherzustellen, welches aktuell mit den Verhandlungspartnern vor Ort gesondert zu verhandeln ist. Abschläge sind vorgesehen, wenn ein Krankenhaus nicht an der Pflichtversorgung teilnimmt. Mit Ausnahme zweier universitärer Abteilungen und einiger Kliniken, die nicht in den Landesbettenplänen als Versorgungskliniken definiert sind, nehmen nahezu alle KJPP-Abteilungen und Kliniken in Deutschland an der Pflichtversorgung teil.
Diese dezentrale Verhandlungspraxis ist in einigen Regionen zwar noch tragfähig, jedoch zeigt sich, dass in Kliniken mit hoher Notfallbelastung (tags und nachts) und der Notwendigkeit für nächtliche Präsenzdienste erhebliche Lücken in der regulären stationären Versorgung tagsüber durch den resultierenden Freizeitausgleich gerissen werden. Dies führt zu einer Qualitätseinschränkung der Versorgung und zur kontinuierlichen Gefahr der Unterschreitung der PPP-RL-Vorgaben. Leistungsunabhängige Vorhaltebudgets können an dieser Stelle die Versorgung und die Versorgungsqualität sichern. Ganz abgesehen davon können entsprechende tarifrechtliche Regelungen in der Zukunft z.B. bezogen auf die Arbeitszeiten der Ärzt:innen eine Sicherstellung ärztlicher Bereitschafts- oder Anwesenheitsdienste aus dem Fachgebiet heraus erschweren oder verunmöglichen, was zu komplexen Dienstsystemen unter Einbezug anderer Fachgebiete bei gleichzeitiger Sicherstellung des Facharztstandards führen kann.
Es mangelt jedoch an einer bundesweit einheitlichen Definition der regionalen Pflichtversorgung. Die vom G-BA für die Datenerhebung gewählte Beschreibung (geschlossene Stationen, geschlossene Bereiche, 24-Std-Bereitschaftsdienst, gesetzlich und landesrechtlich untergebrachte Patient:innen) lehnen wir als ungeeignet ab. Durch die Verknüpfung von Freiheitsentzug und ökonomischen Mehrleistungen werden Fehlanreize geschaffen, die dem Ziel der Reduktion von Freiheitsentzug im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention widersprechen. Vermeidung von Zwang und moderne „fakultativ geschlossene“ Versorgungskonzepte würden strukturell benachteiligt werden zu Lasten der jungen Patient:innen.
4. Flexible teilstationäre Belegung vollstationärer Betten
Bundesweit wird bereits etwa die Hälfte der Behandlungskapazität teilstationär erbracht. Eine Flexibilisierung der vollstationären Behandlung und Nutzung der Angebote für die anderen Versorgungsformen wie stationsäquivalent und teilstationär ist für Gruppentherapien und Fachtherapien bereits üblich, und wurde auch in die PPP-RL aufgenommen (eine Behandlung teilstationär solle auf der gleichen Station möglich sein). Dennoch geht die PPP-RL von einer „Station“ als einer „räumlich und organisatorisch abgegrenzten Einheit“ mit fest zugeordnetem Personal und einer festen Patientenzahl nach festgelegten Kategorien aus. Das Konzept gehört breiter flexibilisiert als nur für teilstationäre Patient:innen. Stationsäquivalente und ambulante Patient:innen sollten ebenso einbeziehbar sein, und Patient:innen in der Entlassphase sollten – sofern die Klinik wohnortnah liegt – jederzeit teilstationär oder stationsäquivalent oder auch ambulant geführt werden können. Dabei wäre noch die Frage des Besuches der Schule für Kranke zu klären, die aber nicht der Bundesgesetzgebung, sondern den Kultusministerien der Länder zugeordnet ist. Für Fälle mit weiter geltender Krankenhaus-Behandlungsindikation kann für die weitere soziale Stabilisierung der fortlaufende Besuch der Schule für Kranke konstituierend sein.
5. Modellprojekte mit Regionalbudget oder sektorenübergreifenden Quartalspauschalen
Ein Regionalbudget unter Fallenlassen aller anderen strukturellen Zwänge halten wir für ein perspektivisch sehr sinnvolles und attraktives Modell. Es vereint die Vorteile des Übergangs von „Betten“ zu „Fällen“ durch die „Capitation“ der Vergütung und zwingt von der Anlage her dazu, möglichst ambulante, auch ambulant-aufsuchende Behandlung anzubieten. Des Weiteren lässt sich in einem solchen Modell ein personenzentrierter Ansatz mit einer auf die Bedarfe der jeweiligen Patient:innen und ihrer Familien zugeschnittenen Versorgung am besten verwirklichen. Es muss aber alle Krankenkassen umfassen, sonst ist es für die vergleichsweise kleinen KJPP-Einheiten nicht machbar. Modellvorhaben nach § 64b SGBV für die Kinder- und Jugendpsychiatrie sind infolge des gesetzgeberisch ausgebliebenen Kontrahierungszwanges für alle Krankenversicherungen leider nicht repräsentativ entstanden. Eine sektorenübergreifende Versorgung müsste für eine flächendeckende Erreichbarkeit unserer Patient:innen infolge der sehr großen Einzugsgebiete der Krankenhäuser unter Einbeziehung der – meist als sozialpsychiatrische Praxen geführten – niedergelassenen Ärzt:innen und der Psychotherapeut:innen gleichzeitig erfolgen können. Allerdings werden die Sektorengrenzen derzeit durch nicht sinnvolle Leistungsausschlüsse sogar zementiert (z.B. zwischen Behandlung nach der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung und parallel psychiatrischer Institutsambulanz). Wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung entsprechender Strukturen ist die Weiterentwicklung der Institutsambulanzen im Sinne eines intensivambulanten Settings zur Reduktion und Verkürzung stationärer Behandlungen (s.o.). So kann in der Perspektive ein bedarfsgerechter stepped-care Ansatz geschaffen werden.
Zusammenfassend…
… sind die Voraussetzungen in der KJPP gegenüber somatischen Fächern grundlegend anders. Weder bestehen Anreize zu nicht bedarfsgerechter Leistungsausweitung, noch besteht Überversorgung.
… ist eine Übertragung des vorgestellten Level-Systems auf die KJPP nicht möglich. Die Entgeltlogik des PEPP ist grundsätzlich anders als das DRG System. Wir sehen keinen raschen Handlungsbedarf hinsichtlich einer kompletten Umstellung der Finanzierung.
…ist die Zuteilung in Leistungsgruppen für die KJPP fachlich nicht sinnvoll und nicht praktikabel.
… sind einzelne Elemente der Reformvorhaben wie Regionalbudgets oder leistungsunabhängige Grundfinanzierungen mit Modifikationen für die KJPP denkbar und interessante Entwicklungsoptionen.
… muss KJPP-Versorgung zwingend wohnortnah und sektorübergreifend erfolgen. Der Trend zur Zentralisierung kann in der KJPP nicht mitgegangen werden.
… möchten wir ausdrücklich vor „Schnellschüssen“ warnen, wenngleich Reformbedarf besteht.
Der Reformbedarf zeigt sich insbesondere in folgenden Bereichen:
- Die unflexible PPP-RL muss durch eine patientenorientierte Personalbemessung und Krankenhausfinanzierung (wie z.B. das Plattformmodell) ersetzt werden.
- Die „Regionale Pflichtversorgung“ benötigt eine bundesweit einheitliche fachgebietsspezifische Definition.
- Eine Ambulantisierung stationärer Behandlungen und Sicherstellung der Versorgung bei fehlenden Personalkapazitäten ist nur durch eine Reform der Finanzierung von Psychiatrischen Institutsambulanzen erreichbar.
- Der Widerstand der Kostenträger gegen die Stationsäquivalente Behandlung sollte unterbunden und die Rahmenbedingungen der Stationsäquivalenten Behandlung so gefördert werden, dass eine weitere Verbreitung möglich ist. Auch bedarf es eines „Zwischenschritts“ zwischen stationsäquivalent und ambulant.
- Eine neue Phase von Modellprojekten ohne Kontrahierungszwang ist zu vermeiden. Erfolgreiche Modelle müssen in der Fläche implementierbar werden.
- Es gibt umfangreiche Vorarbeiten unter Förderung des BMG mit priorisierten Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Versorgung für psychisch kranke Minderjährige
(vgl. Handlungsempfehlungen der Aktion Psychisch Kranke).
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Für die DGKJP
Prof. Marcel Romanos
Prof. Michael Kölch
Prof. Renate Schepker
Für die BAG KJPP
Dr. Martin Jung
Dr. Marianne Klein