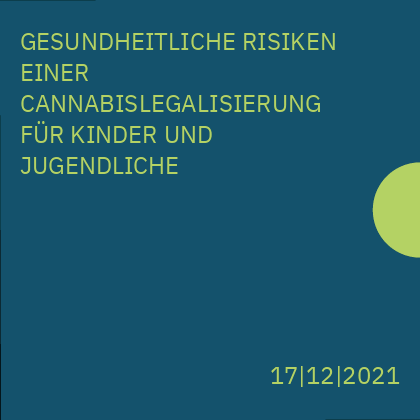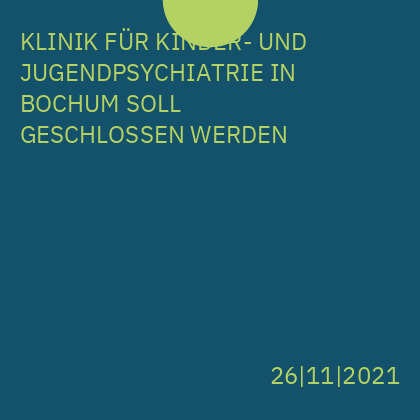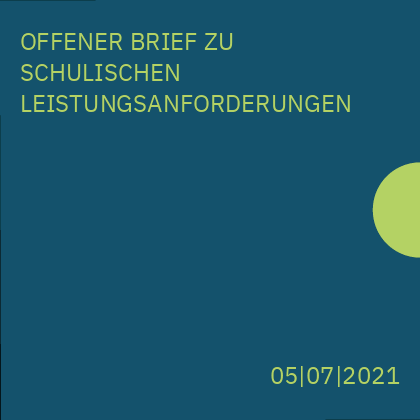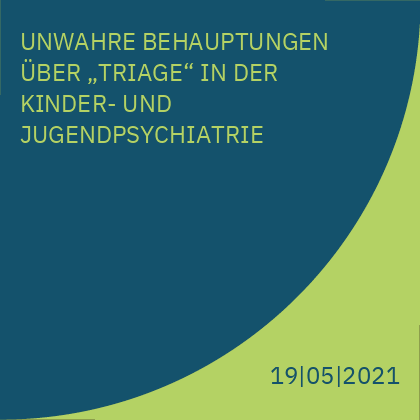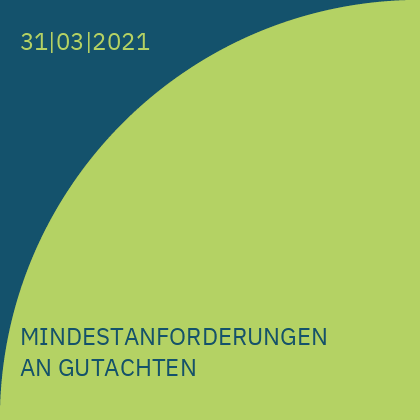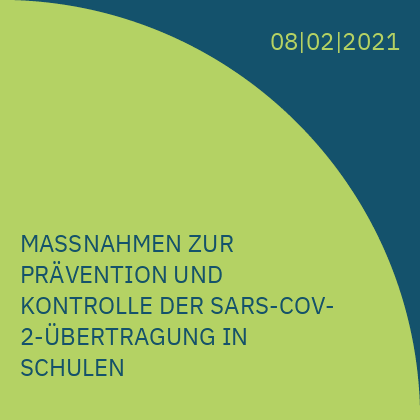Appell der kinder- und jugendpsychiatrischen und kinder- und jugendmedizinischen Fachgesellschaften und Verbände in Deutschland
Die Kinder- und Jugendpsychiater:innen und –psychotherapeut:innen und die Kinder- und Jugendärzt:innen in Deutschland warnen vor den möglichen Risiken einer Cannabislegalisierung und appellieren, etwaige Legalisierungsbestrebungen nicht auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen auszutragen. Alle Vorsätze, die Legalisierung mit einem bestmöglichen Jugendschutz zu verbinden, haben sich in vielen Legalisierungsländern als Illusion erwiesen. Bereits die gesellschaftliche Debatte um eine Abgaberegulierung von Cannabisprodukten hat ungünstige Effekte auf das Konsumverhalten junger Menschen. Suchtprävention hat in der Vergangenheit erwünschte Effekte gezeigt, wenn sie auf eine strikte Angebotsreduzierung zielt. Den Markt suchterzeugender Substanzen zu erweitern und auf eine schadensbegrenzende Beeinflussung von Gefährdeten und Konsumierenden durch Verhaltensprävention zu setzen hat sich demgegenüber als kaum wirksam herausgestellt.
Studien aus den USA belegen, dass die Legalisierung von Cannabis auch dann, wenn dies nur für erwachsene Personen vorgesehen ist, doch auch für Jugendliche mit starken Zuwächsen beim Cannabismissbrauch sowie der Entwicklung einer Cannabisabhängigkeit einhergehen [1]. Infolge der Legalisierung hat die Risikowahrnehmung in Bezug auf die gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums insbesondere bei den Minderjährigen abgenommen, trotz aller Beschränkungen des legalen Erwerbs auf Erwachsene [2]. In manchen US-Bundesstaaten mit einer Legalisierung liegen die Konsumquoten in der Bevölkerung um 20 bis 40 Prozent höher als im US-Bundesdurchschnitt [1,3]. Cannabisprodukte, die von Erwachsenen legal erworben werden, werden trotz Verbots an Jugendliche durchgereicht [4,5].
Die Folgen für die medizinische Versorgung von Cannabiskonsumierenden sind alarmierend. In Colorado (USA) hat sich seit der Legalisierung des Cannabisbesitzes die Rate der cannabisbedingten Vergiftungsfälle und cannabisbezogenen Krankenhausaufnahmen mehr als verdoppelt [6,7,8,9]. Bei den cannabisbezogenen Notrufen in Vergiftungszentralen werden die größten Zuwächse in den Altersgruppen 0 bis 8 Jahre und 9 bis 17 Jahre verzeichnet [6,10,11]. Der Anteil der Suizide mit Cannabisbeteiligung ist in Colorado seit der Legalisierung auf das Doppelte angestiegen. Bei den 10- bis 17-Jährigen liegt der Anteil der Suizide mit Cannabisbeteiligung mit 51 Prozent am höchsten [12]. Die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle unter Cannabiseinfluss ist in Colorado nach der Legalisierung ebenfalls auf das Doppelte angestiegen [6,12,13,14].
Zudem zeigt die Legalisierung in den USA und Kanada, dass die angestrebte Austrocknung des Schwarzmarktes nur bedingt gelingt und sich Konsumierende die Cannabisprodukte zu einem nicht geringen Anteil auch weiterhin über illegale Quellen beschaffen. Insbesondere jüngere Konsumentengruppen nutzen die günstigeren Schwarzmarktprodukte bevorzugt. Neben dem fortbestehenden Schwarzmarkt erweisen sich Probleme in der Marktregulierung, Schmuggel und Steuerbetrug bisher als unlösbar [12,15,16].
Die Legalisierung verharmlost auch die gesundheitlichen Gefahren, negativen Folgen und Langzeiteffekte des Cannabiskonsums auf die altersgerechte physische und psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in Auftrag gegebene CaPRiS-Studie (Cannabis: Potential und Risiken) zeigt, dass das Abhängigkeitspotenzial für Jugendliche besonders hoch ist [17]. Etwa 9 Prozent aller CannabiskonsumentInnen entwickeln über die Lebenszeit eine Cannabisabhängigkeit. Diese Rate beträgt 17 Prozent, wenn der Cannabiskonsum in der Adoleszenz beginnt bzw. 25 bis 50 Prozent, wenn Cannabinoide in der Adoleszenz täglich konsumiert werden [18].
Die Befunde zu den ungünstigen Einwirkungen auf die Hirnreifung junger Menschen mehren sich seit einer Dekade [19,20]. Cannabiskonsum in Pubertät und Adoleszenz führen zu strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn mit der Folge von Einbußen in Gedächtnis-, Lern- und Erinnerungsleistungen sowie Minderungen der Aufmerksamkeit, Denkleistung und Intelligenz [21,22,23,24]. Da die Hirnreifung bis über die Mitte der dritten Lebensdekade hinausreicht, sind Abgaberegulierungen mit Altersbegrenzungen bei 21 oder gar 18 Jahren aus entwicklungsneurobiologischer Sicht nicht plausibel.
Weiterhin ist der Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und psychischen Störungen gut belegt. Bei vulnerablen Personen besteht ein dosisabhängiger Zusammenhang mit depressiven Störungen, Suizidalität, bipolaren Störungen, Angsterkrankungen sowie zusätzlichem Missbrauch von Alkohol und anderen illegalen Drogen [25]. Cannabiskonsum kann bei ansonsten unauffälligen Menschen mit einer bestimmten genetischen Disposition Psychosen auslösen und den Verlauf schizophrener Psychosen deutlich verschlechtern [26]. Bei Cannabiskonsum in der Schwangerschaft werden Frühgeburten und Entwicklungsstörungen des Kindes beobachtet [27].
Intensiv Cannabis konsumierende Kinder und Jugendliche brechen häufiger die Schule ab und weisen ungünstigere Bildungsabschlüsse als ihre nichtkonsumierenden Altersgenossen auf [28].
Die Programmatik der deutschen Cannabispolitik hat sich mit Blick auf Konsumquoten und Hilfestellungen für Suchtkranke in der Vergangenheit bewährt. Sie fußt auf vier Säulen: Prävention, Hilfen, Schadensminimierung und Angebotsreduzierung (BtMG) [29]. In der deutschen Bevölkerung liegen nach Daten der EBDD die Quoten täglichen oder fast täglichen Cannabisgebrauchs im europäischen Vergleich niedrig (mit 0,4% für die Gesamtbevölkerung auf dem 5. Rang von 14 Ländern insgesamt, europäischer Durchschnitt 0,7%) [30]. Auch hat die Zahl regelmäßig konsumierender Jugendlicher nach Analysen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in den vergangenen 30 Jahren nicht bedeutsam zugenommen [31]. Hinsichtlich der Inanspruchnahme therapeutischer Hilfen lässt sich feststellen, dass kaum irgendwo anders in Europa vergleichbar viele Cannabisabhängige in eine Suchtbehandlung vermittelt werden wie in Deutschland [30].
Diese erfolgreiche Programmatik inklusive ihrer strikten Angebotsreduzierung sollte fortgesetzt und nicht etwa durch ungünstige Folgen einer Legalisierung beeinträchtigt werden wie sie aus den USA und Kanada in der wissenschaftlichen Literatur berichtet werden. Aufklärung über Gesundheitsgefahren, Resilienzförderung im Kindes- und Jugendalter, Jugendschutzgesetzgebung und Therapieforschung müssen zukünftig gestärkt werden, um das Risikobewusstsein junger Menschen zu schärfen, ihre Widerstandskraft gegen verfrühten Substanzkonsum zu erhöhen und die noch allzu schwachen Interventionserfolge weiter zu verbessern.
Berlin/Mainz/Schleswig, 16.12.2021